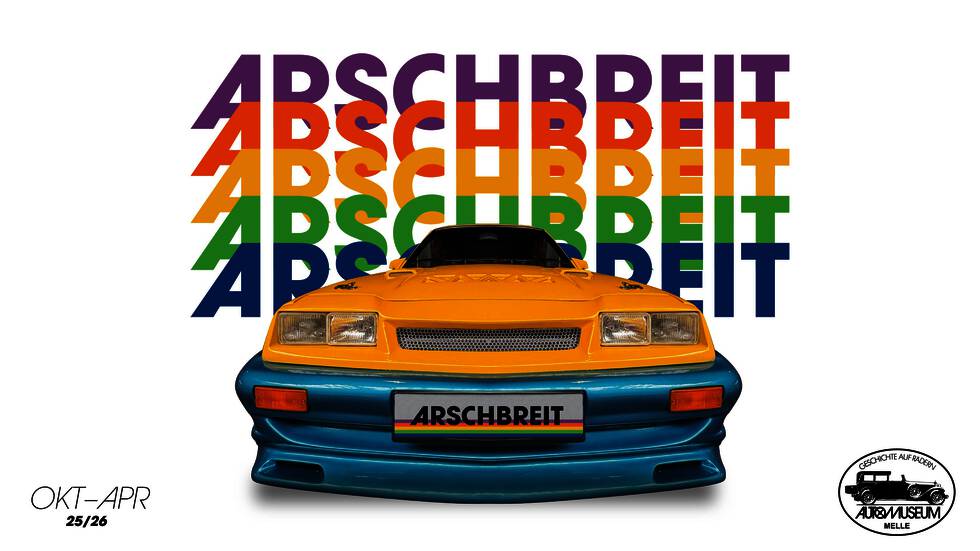Garage der Erinnerungen - das Automuseum Melle
Hinter der Fassade einer denkmalgeschützten Fabrik können Sie die Geschichte des Automobils auf ungewöhnliche Weise entdecken: Das Automuseum Melle präsentiert auf drei Etage über 300 Fahrzeuge aus aus verschiedenen Epochen des Automobilbaus.
Das Besonderes unseres Museums ist jedoch das Konzept: Alle unsere Exponate sind fahrbereit und werden auch noch regelmäßig genutzt. Das macht unsere Ausstellung so lebendig, dass Sie bei jedem Besuch etwas neues entdecken können.
Besuchen Sie uns und erleben die Geschichte des Automobils in der Garage der Erinnerungen.
AFTER-WORK-FÜHRUNGEN
Fakten - Zusammenhänge -Hintergrundinformationen
Wann: Jeden zweiten Mittwoch im Monat -
Uhrzeit: 18:00 bis 19:30 Uhr -
Preis: 13,- € pro Person, inklusive Eintrittskarte zum Museum
Was Sie erwartet: Die Führung ist mehr als nur ein einfacher Rundgang durch das Museum. Unter der Leitung eines erfahrenen Guides entdecken die Teilnehmer die Welt der Automobile aus einer einzigartigen Perspektive. Die Tour beleuchtet nicht nur die zahlreichen Fahrzeuge der Sammlung, sondern bietet auch interessante Fakten, erhellende Zusammenhänge und tiefere Hintergrundinformationen zu den Exponaten. Diese Mischung aus fundiertem Wissen und spannenden Anekdoten bringt den Besuchern die Geschichten hinter den ausgestellten Autos näher. Egal, ob es sich um klassische Oldtimer, seltene Modelle oder besondere technische Entwicklungen handelt, jede Führung hat ihren eigenen besonderen Charme und bietet immer wieder neue spannende Erkenntnisse.
Die „After-Work-Führung“ stellt eine ideale Gelegenheit dar, einen unterhaltsamen und informativen Abend im Automuseum Melle zu verbringen und sich mit Gleichgesinnten über die Faszination Automobil auszutauschen. Ob eingefleischte Autoliebhaber oder Neulinge im Thema – die Führung bietet für jeden spannende Einblicke. Tauchen Sie ein in die Welt der Automobile und lassen Sie sich bei dieser besonderen Führung von der Geschichte und Technik der Fahrzeuge begeistern.
Anmeldung: Da die Teilnehmerzahl beschränkt sein könnte und die Veranstaltungen oft sehr gefragt sind, wird eine vorherige Anmeldung empfohlen. Interessierte können sich telefonisch unter der Nummer 05422 - 46838 oder per E-Mail an info@automuseum-melle.de anmelden.
Das Automuseum Melle lädt an jedem zweiten Mittwoch des Monats zur „After-Work-Führung“ ein, einer besonderen Veranstaltung, die speziell für jene konzipiert ist, die nach einem langen Arbeitstag in die faszinierende Welt der Automobilgeschichte eintauchen möchten. Diese geführte Tour bietet eine hervorragende Gelegenheit, tiefergehende Einblicke in die umfangreiche Sammlung des Museums zu erhalten.